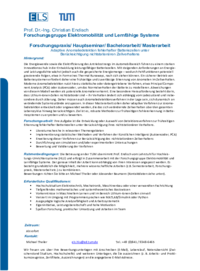Adaptive Anomaliedetektion fehlerhafter Batteriezellen unter Berücksichtigung nichtstationären Zellverhaltens
- Institut
- Elektromobilität und lernfähige Systeme (THI-IIMO)
- Typ
- Bachelorarbeit Semesterarbeit Masterarbeit
- Inhalt
- experimentell theoretisch
- Beschreibung
Die Energiewende sowie die Elektrifizierung des Antriebsstrangs im Automobilbereich führen zu einem starken Innovationsschub in der Entwicklung leistungsfähiger Batteriezellen. Mit steigenden Anforderungen an Energieund
Leistungsdichte wächst jedoch auch die gespeicherte Energiemenge – wodurch Fehlfunktionen potenziell gravierende Folgen, etwa in Form eines Thermal Runaways, nach sich ziehen können. Ein sicherer Betrieb von
Batteriesystemen erfordert daher eine frühzeitige und zuverlässige Erkennung von Anomalien im Zellverhalten. Moderne Anomaliedetektion nutzt hierzu statistische oder datengetriebene Verfahren, etwa Principal Component
Analysis (PCA) oder Autoencoder, um das Normalverhalten der Batterie zu modellieren. Abweichungen von diesem Modell werden als potenzielle Anomalien erkannt. Eine besondere Herausforderung besteht darin,
dass Lithium-Ionen-Zellen nichtstationär sind – ihr Verhalten ändert sich abhängig vom Ladezustand und insbesondere durch Alterung. Daher müssen auch Anomaliedetektionsverfahren in der Lage sein, sich dynamisch an
verändernde Systemzustände anzupassen. In dieser Masterarbeit sollen daher adaptive Verfahren zur Anomaliedetektion entwickelt oder angewendet werden, die das sich verändernde Zellverhalten über den gesamten Lebenszyklus hinweg berücksichtigen. Ziel ist es, robuste Methoden zur frühzeitigen Fehlererkennung in Batteriesystemen zu erproben und zu bewerten.
Forschungsarbeit: Ihre Aufgabe ist die Entwicklung oder Auswahl von Detektionsverfahren zur frühzeitigen Erkennung fehlerhafter Batteriezellen unter Berücksichtigung ihres nichtstationären Verhaltens.- Literaturrecherche in relevanten Themengebieten
- Implementierung statistische Methoden und Verfahren der Künstlichen Intelligenz (Autoencoder, PCA)
- Erweiterung dieser Verfahren zur Berücksichtigung des nichtstationären Zellverhaltens
- Durchführung von simulativen und/oder experimentellen Untersuchungen
- Bewertung und Validierung der Verfahren
Rahmenbedingungen: Die Betreuung an der TUM übernimmt Prof. Endisch vom Lehrstuhl für Hochleistungs-Umrichtersysteme (HLU) und erfolgt in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe Elektromobilität und Lernfähige Systeme. Der genaue Inhalt der Arbeit kann abhängig von Ihren Interessen angepasst werden. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, mehrere wissenschaftliche Arbeiten (z.B. Semesterarbeit, Forschungspraxis, Masterarbeit etc.) zu kombinieren.
- Voraussetzungen
Hochschulstudium Elektrotechnik, Mechatronik, Maschinenbau oder einer verwandten Fachrichtung
- Tiefgreifendes mathematisches und systemtheoretisches Basiswissen
- Vorkenntnisse in Maschinellem Lernen und im Bereich Lithium-Ionen-Zellen sinnvoll
- Versiert im Umgang mit Programmiersprachen wie MATLAB/Simulink oder Python
- Ausgeprägte logische Analysefähigkeit und Arbeitssystematik
- Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und hohe Motivation
- Spaß an Forschung, praktischer Umsetzung und Arbeiten im Team
- Möglicher Beginn
- sofort
- Kontakt
-
Prof. Dr.-Ing. Christian Endisch
els.hlued.tum.de - Ausschreibung
-